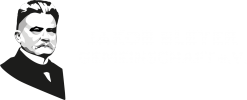Deutsche in Ungarn nach dem Ersten Weltkrieg
Von Georg Richter (2012)
Geschichtlicher Hintergrund
Mit der Eroberung Konstantinopels im Jahr 1453 vernichtete Mohamed II. das Oströmische Reich. Schon vorher eroberten die Türken 1361 Adrianopel und besiegten 1389 Serbien in der Schlacht auf dem Amselfeld, dem heutigen Kosovo. Unter Mohamed II. und seinen bedeutenden Nachfolgern Selim I. und Süleiman II. erreichte das Osmanische Reich den Höhepunkt seiner Macht. Es umfasste in Europa die gesamte Balkanhalbinsel und nach der Schlacht bei Mohatsch 1526 den größten Teil Ungarns. Die türkische Herrschaft in Ungarn dauerte 150 Jahre. Als die Türken 1683 Wien erfolglos belagerten, holten die kaiserlichen Truppen zum Gegenschlag aus. Außer Osterreichern und Polen kämpften auch badische, bayerische und württembergische Regimenter gegen die Türken. Die entscheidende Wende leitete der polnische Heerführer Jan Sobieski in der siegreichen Schlacht auf dem Kahlenberg nördlich von Wien ein. Prinz Eugen von Savoyen, Max Emmanuel von Bayern und Ludwig von Baden (genannt Türkenlouis) befreiten in den folgenden Jahrzehnten Ungarn von der Türkenherrschaft. Um das darniederliegende und verwüstete Land aufzubauen, benötigte man Siedler, besonders Bauern und Handwerker aus dem Ausland. Während der Regierungszeit der Habsburger Kaiser Karl VI., Kaiserin Maria Theresia und Kaiser Josef II. wanderten viele Kolonisten nach Ungarn vornehmlich aus Süddeutschland ein, weil dort die Anbaumethoden und die Technik als die fortschrittlichsten galten. Dem Ruf der Werber folgten Siedler aus Baden, Schwaben, Bayern, Hessen, Franken, der Pfalz, der Schweiz, dem Elsass, Lothringen, Österreich u.a. nach Ungarn. Sie wurden stets „Schwaben“ genannt, obwohl nur ein Teil von ihnen aus Schwaben stammte. Nach dem Ersten Weltkrieg wurden diese etwa zwei Millionen Menschen — zur Unterscheidung von den Schwaben in ihrem Stammland – zuerst in der Fachliteratur und dann auch allgemein „Donauschwaben“ genannt.
Nachfolgend geht es um das Schicksal der Deutschen in Ungarn nach dem Ersten Weltkrieg, vornehmlich in Nadwar (heute H-6345 Nemesnádudvar). Der Versailler Frieden (ungarisch heißt es „Trianon“ nach dem Schloss Trianon, das unmittelbar neben dem Versailler Schloss liegt) nach dem Ersten Weltkrieg amputierte Ungarn auf 30% seiner früheren Staatsgröße von 325.000 Quadratkilometer auf 93.000, und zwang zwei‘ Drittel der ungarischen Nation unter Fremdherrschaft. Unter diesem Trauma leidet Ungarn noch heute. Viele ungarische Einwohner Großungarns strömten nach 1920 ins heutige Rumpfungarn und verbreiteten dort ihre chauvinistischen Ansichten. „Nein, nein, niemals“ lauteten ihre Parolen. Verantwortlich gemacht fi.ir diese nationale Katastrophe wurden die Minderheiten. So haben sich die Banater Schwaben in einem Memorandum an die Friedenskonferenz von Paris am 19. August 1919 mehrheitlich für Rumänien entschieden, nicht für den Verbleib in Ungarn. In dem Memorandum beklagten sich die Banater Schwaben über die ungarische Unterdrückung seit Jahrhunderten. In Rumpfungarn begann nach 1920 eine rigorose Magyarisierungspolitik. Ungarn behandelte seine Minderheiten unter allen Nachfolgestaaten am schlechtesten. Dem häufigen Besuch des ungarischen Parlamentariers und erklärten Antisemiten und Deutschenfeinds Zoltán Meskó in Nadwar und des örtlichen Notars Kelle ist es im Wesentlichen zuzuschreiben, dass der ungarische Anteil der Nadwarer Bevölkerung von 6% oder 123 Einwohnern im Jahr 1920 (Einwohnerzahl 2.297) bei der Volkszählung 1941 auf 41,6% oder 1.288 kletterte, obwohl es die gleichen Menschen waren (Gesamteinwohnerzahl 1941: 3.097). Zweifellos haben wir hier den Fall, dass der Deutsche nur in der Statistik Magyare geworden ist. In diese Schwächezone der Schwaben suchte nun das Magyarentum einzubrechen. Hinzu kam, dass der erwähnte Notar Kelle ein magyarisierter Schwabe und wütender Deutschenhasser war. Obwohl vollkommen der deutschen Sprache mächtig, ließ er sich ein in Deutsch vorgebrachtes Anliegen ins Ungarische übersetzen und antwortete ungarisch.
Woher kam dieser Deutschenhass? Welche Auswirkungen hatte er auf den Einzelnen?
In der geistigen Auseinandersetzung über die Ursachen der nationalen ungarischen Katastrophe nach dem Ersten Weltkrieg wurden zwei Gruppen als innere Feinde des Magyarenturns ausgemacht: Die Juden und die Schwaben (man nannte und nennt in Ungarn alle Deutschen Schwaben). Der Literat Dezső Szabó prägte die herrschende Stimmung nach 1920 mit seiner Meinung Juden und Schwaben würfen sich gleichermaßen gierig und hemmungslos auf magyarische Güter. Die Juden drängen in die intellektuellen Laufbahnen wie Arzte, Rechtsanwälte, Notare u.a.m. hinein und die Schwaben kaufen den ungarischen Boden auf. Dazu muss man wissen, dass Literaten in Ungarn mehr gelten als Politiker. So auch der Dichter und Herder Preisträger (!) Gyula Illyés (1902-1983): Die deutsche Minderheit sei von den Habsburgern nach den Türkenkriegen mit der Absicht angesiedelt worden Ungarn zu germanisieren. Und da – so Illyés weiter
— 200 Jahre Gastfreundschaft „keine so lange Zeit im Leben einer Nation sind, dass man diese nicht kündigen könnte, besonders wenn der Gast dieser Gastfreundschaft nicht mehr würdig ist“, könne man sie getrost vertreiben. Im Programm der Nationalen Bauernpartei (Kisgazdapárt) 1939 wurde die „zur Macht strebende Mittelschicht schwäbischer, jüdischer und mährischer Herkunft“ als gleiche Gefahr bezeichnet. Diese Hysterie hatte insofern einen rationalen Kern, als die ungarische Intelligenz zum erheblichen Teil aus Assimilanten bestand. Ungarische Sozialpolitiker planten schon in den 1930er Jahren, das jüdische und schwäbische Vermögen neu aufzuteilen. Eine Aussiedlung der Ungarndeutschen hätte das Nationalvermögen beträchtlich vermehren sollen, da diese ihre wichtigsten Werte, den Boden und die landwirtschaftliche Ausrüstung, auf keinen Fall hätten mit sich nehmen können.
Parallel zu den Rassengesetzen des Dritten Reiches entstanden auch in Ungarn neben der Rassenpolitik der Regierung zahlreiche Vereine zum Schutz der ungarischen Rasse, die es ebenso wenig gibt wie den Begriff „Arier“. Als Beispiel von vielen Rassevereinen zitiere ich aus Krisztián Ungvárys Aufzählung die „Magyarische Gemeinschaft“ (Magyar Közösség). Der in der Juli- Ausgabe 1941 der Zeitschrift „Magyar Élet“ (Ungarisches Leben) als Bekenntnis veröffentlichte Magyar Káté (Ungarischer Katechismus) bestimmte, wer nicht als Magyare anzusehen ist: „Wer sich nach der Türkenherrschaft hier niedergelassen hat. Diesen Elementen müsse die Auswanderung erleichtert werden“, fügte der Káté hinzu. Im Hintergrund dieser Aufforderung stand die Annahme, dadurch werde die gesellschaftliche Integration der darbenden ungarischen Bauern und Agrarproletariern ermöglicht. „Die Ansiedlung großer magyarischer Massen würde die schwäbische Bevölkerung schwächen“ so János Kodolányi, Führungsmitglied des Magyar Káté in der Juli-Ausgabe 1941 der Zeitschrift Magyar Élet.
Obwohl nach dem Überfall Nazi-Deutschlands am 22. Juni 1941 auf die Sowjetunion auch ungarische Truppen an der Seite Deutschlands kämpften, insbesondere waren die Truppen am Don im Einsatz, herrschte in Ungarn ein hemmungsloser Deutschenhass. Ich war ein 12 Jahre alter Gymnasiast im Jesuitengymnasium Kalocsa, als Hitler sich am 13. März 1938 Osterreich einverleibte. In der Turnstunde ließ Turnlehrer János Csapp alle Schwaben heraus- treten. Von den etwa acht Schwabenmitschülern traten nur Kurt Bayer aus Zanegg (Mosonszolnok) und ich heraus. Wir ahnten nicht warum, bis Turnlehrer Csapp uns sagte, Hitler habe Österreich besetzt. Kaum ausgesprochen erhielten wir rechts und links so kräftige Ohrfeigen, dass ich Sterne sah. Sich darüber zu beschweren, hätte nichts gebracht. Die Turnstunde lief weiter, als wäre nichts vorgefallen. Ich habe den Vorfall auch für mich behalten. Im damaligen Ungarn klang der Begriff Schwabe dermaßen abschätzig, dass ich mich wegen meines Deutschtums schämen musste. Häufig kam ich mir vor wie ein von der Herrschaft gedemütigter, in die Ecke verkrochener Hund. Ich fühlte mich von der Gesellschaft verachtet und ausgegrenzt. Gefragt war der „Rasseungar“ mit adeligen Vorfahren, alles andere galt nichts. Natürlich gab es auch andere Lehrer als János Csapp. Dazu zählte mein Klassen- und Geschichtslehrer Dr. József Takács, ein grundsolider, gerechter Ungar aus Güns/Kőszeg (Westungarn). Sein Motto lautete: „Mir ist es gleich, ob jemand Ungar, Slowake oder Schwabe ist, bei mir zählen nur die Leistungen, sonst nichts.“ Das hat mich beruhigt, ich konnte mich dem Studium widmen. Da ich ein guter bis sehr guter Schüler war, erwachte in mir ein neues Selbstbewusstsein. In der fünften Gymnasialklasse (Quinta) wurde ich als Klassenbester mit einer Goldmedaille ausgezeichnet.
Schon ab der vierten Klasse (Quarta) hatte ich durchgehend sehr gute Noten. Ein zweites krasses Beispiel des Deutschenhasses erfuhr ich aus Berichten anlässlich der Flucht im Oktober 1944. Die Donaubrücke bei Badesek/Bátaszék-Baaja/Baja wurde durch feindliche Bombenangriffe zerstört, man konnte fortan die Donau nur noch mit der Fähre überqueren. Weil eine verhältnismäßig steile Straße bis zur Fähre zu überwinden war, halfen auch ungarische Soldaten mit, den Fluchtwagen zu schieben. Ein Soldat bemerkte dabei: „Man sollte alle Schwaben in die Donau werfen, damit Friede einkehrt.“ Dieser Ausspruch war ernst gemeint, es widersprach niemand. Die gleichgeschaltete ungarische Presse geiferte, keiner wagte den Deutschenhass — übrigens auch den Judenhass – zu hinterfragen oder gar zu kritisieren.
Die Vertreibung der Deutschen aus Ungarn
Das Schicksal des ungarländischen Deutschtums war schon sieben Monate vor der Potsdamer Konferenz (17. Juli bis 2. August 1945) entschieden. Entschieden haben es nicht die alliierten Großmächte, sondern die ungarische Regierung. Betrachtet man die Bodenreform-Verordnung Nr. 600/1945 und deren drei Durchführungsbestimmungen, die Tätigkeit des durch die Verordnung Nr. 3 820/1945 ME errichteten Amtes für Volksbetreuung, den seit Anfang April 1945 fix und fertigen, aus acht Punkten bestehenden und sämtliche Personen deutscher Nationalität mit Aussiedlung und Vermögenskonfiszierung bestrafenden Gesetzesentwurf der Nationalen Bauernpartei sowie die einzurichtenden Internierungs- und Arbeitslager als Glieder einer Kette, dann kann man zu keinem anderen Schluss kommen, als dass das Ziel die Vernichtung der Existenzgrundlage und dadurch des Nationalitätendaseins der zu 80 Prozent bäuerlichen Volksgruppe die Liquidierung der deutschen Nationalität selbst war. Und all das noch vor Potsdam. Die Vertreibung der ungarländischen Deutschen war von der ungarischen Regierung initiiert worden und zwar am 8. Mai 1945, als sie sich an die alliierte Kontrollkommission wandte mit der Bitte, sie möge die Vertreibung der Volksbundmitglieder, deren Zahl sie zunächst auf 300.000, später auf 200.000 bis 250.000 bezifferte, in die sowjetische Besatzungszone Deutschlands ermöglichen. Soviel Volksbundmitglieder hatte es in Ungarn aber gar nicht gegeben, allenfalls 130.000. Zur Zeit der Potsdamer Konferenz stand also der ganze grausame Vertreibungsmechanismus schon in voller Startbereitschaft. Potsdam hat daran nur so viel geändert, dass es die Vertreibung gestoppt (also nicht angeordnet hat), um die Flüchtlingsmassen in Deutschland gleichmäßig verteilen und die ganze Aktion unter „humanen“ Umständen abwickeln zu können. Die ungarische Regierung konnte nicht schnell genug die Vertreibung ihrer Deutschen in Gang setzen. Sie hat das Gesetz am 22. Dezember 1945 angenommen, auf dem der Acht-Punkte-Entwurf der Nationalen Bauernpartei beruhenden, von der Kollektivschuld ausgehenden Vertreibungsverordnung Nr. 12.330/1945 vollzogen worden ist. Diese Gesetze und Verordnungen hatten nur einen Zweck, den Schwaben die Grundstücke und Häuser wegzunehmen, um eine Bodenreform durchzuführen und ungarische Flüchtlinge in den Häusern der vertriebenen Schwaben unterzubringen. Weil diese Gesetze rechtswidrig waren, wurden sie Jahrzehnte später vom ungarischen Verfassungsgericht ausnahmslos aufgehoben. Dazu schreibt der amtierende ungarische Staatspräsident László Sólyom im Grußwort anlässlich der Einweihung des Zentralen Ungarischen Denkmals in Wudersch/Budaörs (neben Budapest) am 18. Juni 2006 zur Erinnerung an die Vertreibung der Deutschen aus Ungarn nach dem Zweiten Weltkrieg:
„Als Staatspräsident entschuldige ich mich bei den vertriebenen Schwaben und ihren Familien für das ihnen widerfahrene Unrecht und die Ungerechtigkeit und verneige mich vor dem Denkmal der Erinnerung in der Hoffnung, dass die Ungarndeutschen hier wieder zu Hause sind.“, heißt es in den Schreiben. „Die Vertreibung der Ungarndeutschen war lange Zeit ein Tabuthema. Nach der Wende 1989 haben wir sofort anerkannt, dass die Verschleppung der Ungarndeutschen ab 1944, die darauf folgenden Internierungen und die Aussiedlung eine Reihe von rechtswidrigen und ungerechten Maßnahmen darstellen, welche die Schwaben unschuldig erlitten haben. Das Verfassungsgericht annullierte die Gesetze über die Kollektivschuld vom Jahre 1945. Jetzt sind wir bereits dabei, die historischen Fakten zu erschließen, wodurch die damaligen Ereignisse nach und nach auch öffentlich zur Kenntnis gelangen“, schreibt der Staatspräsident. “In der Verordnung vom Jahre 1945, auf Grund derer die Volksbundmitglieder und diejenigen, die ihren deutsch- klingenden Familiennamen wieder aufgenommen haben, zu Landesverrätern und volksfeindlichen Verbrechern erklärt wurden, ging es um die Konfiszierung von Grund und Boden. Das zeigt, dass die Vertreibung in erster Linie aus wirtschaftlichen Gründen erfolgte“, geht aus dem Schreiben von Sólyom hervor. Bevor Sólyom Staatspräsident wurde, war er Präsident des Ungarischen Verfassungsgerichts, er weiß also, wovon er spricht.
So viel an den Schwaben zugefügtes Unrecht hat auch Historiker nicht ruhen lassen. Aber im Klima der Polarisierung fanden besonnene Stimmen immer weniger Gehör. Es gab auf beiden Seiten starke Kräfte, die jede Annäherung hintertrieben und das Feuer des Konflikts immer wieder schürten. Prominentester Vertreter der Mahner war István Bibó (1911-1979). Bibó studierte an der Universität Szeged sowie in Wien und Genf Jura. Er hatte zeitweilig den Posten des Innenministers inne, trat jedoch aus Protest gegen die Vertreibung der Ungarndeutschen zurück. Seine Gedanken fasste er in einem Katalog von fünf Forderungen zusammen. Im zweiten Teil seiner Forderungen führt er aus: “Das bewegliche Eigentum wegzunehmen, kann man nicht anders nennen als ganz einfachen Raub, ob es sich um Juden oder um Schwaben handelt. Dass die Schwaben ihr Vermögen als Schmarotzer am Fett des Magyarentums erwarben, ist genauso abwegig wie die Phrase vom jüdischen Parasitentum. Und wenn wir schon nicht auf die Schwaben schauen, dann schauen wir auf uns selbst, und vergessen wir nicht, dass das Leben mit geraubtem Gut eine Demoralisierung mit sich bringt, die schlimmer wiegt als der Wert des geraubten Guts“. Zur Mitgliedschaft beim Volksbund schreibt Bib6 in seiner dritten Forderung: “Wir können sehr wohl wissen, dass genauso, wie viele Ungarn, ohne dass sie Faschisten oder reaktionär gewesen wären, doch aus missverstandenem Patriotismus nach rechts rutschten, viele Deutsche einfach darum dem Volksbund beitraten, weil sie selbstbewusste Deutsche waren und sich nicht einschmelzen lassen wollten“. Wie uns aus der Geschichte bekannt, konnten Bibó‘s Argumente gegen den herrschenden ungarischen Chauvinismus keinen Erfolg haben. Der Grund für die Vertreibung der Ungarn- deutschen und Ausgrenzung der Juden war auch der Neid auf das, was sie an finanziellem und geistigem Reichtum erreicht haben.
In der Regierungssitzung am 22. Dezember 1945, an der die Vertreibung beschlossen wurde, war auch Wiederaufbauminister József Antal sen. von der Nationalen Bauernpartei (Kleinlandwirtepartei FKGP, Kisgazdapárt) anwesend. Seine Äußerung spiegelt den hemmungslosen Deutschenhass wieder: „Aus nationalpolitischer Sicht ist es unzweifelhaft, dass es im Interesse Ungarns steht, dass die Deutschen in so hoher Zahl wie nur möglich das Land verlassen. Nie wieder wird sich eine solche Gelegenheit ergeben, dass wir die Deutschen loswerden. … Heute können wir noch vielen Berechtigten (Neusiedlem) kein Land zuteilen.“ Letzterer Satz beweist, dass die Vertreibung der Deutschen aus Ungarn nur zur entschädigungslosen Enteignung schwäbischer Bauern diente, um deren Grundstücke an National-Ungarn zu verteilen. Es war also – wie István Bibó ausdrückte – „Raub“. Dass Ungarn die Vertreibung der Schwaben beantragt hat, geht aus den protokollierten Aussagen des Staatsministers Mátyás Rákosi in der gleichen Regierungssitzung hervor: „Er ist überrascht, diese Debatte zu hören, da wir selber die Umsiedlung der Deutschen beantragt haben.“
In Ungarn gab und gibt es immer noch immer Akademiker und andere, die behaupten, die Vertreibung der Schwaben sei infolge auswärtiger Einflussnahme zustande gekommen, als ob das Magyarentum von sich aus die „untreuen“ Schwaben nie ausgesiedelt hätte. Dabei sei schon bei der Ankunft der provisorischen Regierung in Budapest am 12. April 1945 in einer Erklärung des Innenministeriums von der Vertreibung der Schwaben die Rede gewesen. Über das Schicksal der Ungarndeutschen hat die provisorische ungarische Regierung schon am 22. Dezember 1944 – am Tage ihrer Konstituierung – per Akklamation entschieden: „Hinaus mit den Schwaben!“ Die Potsdamer Beschlüsse hätten sie nur ermöglicht, wofür den alliierten Mächten zu danken sei… Übrigens hat die ungarische Regierung am 22. August 1946 bei den Verhandlungen mit den Amerikanern selber zugegeben, dass das Potsdamer Abkommen die Aussiedlung der Schwaben nur ermöglicht hatte und dass es an der ungarischen Regierung lag, davon Gebrauch zu machen oder nicht (MIT vom 02. September 1946, Szabad Szó vom 30. August 1946). Die ungarische Regierung hat also längst zugegeben, was von einigen Historikern (und Nicht-Historikern) immer noch bestritten wird. Selbst wenn die Ungarndeutschen allesamt Lämmer gewesen wären, hätten sie am Ende doch gehen müssen, weil es die günstigste Gelegenheit war, sie loszuwerden und ihr Vermögen, Hab und Gut (und darum ging es) zu bekommen. Fast eine halbe Million Schwaben ihrer Heimat zu berauben, sie um ihre Lebensmöglichkeiten zu bringen, sie in die Wüste zu schicken, verstößt gegen jene Ideale, zu deren Schutz die Alliierten die Waffen ergriffen haben, und schwächen jene Hoffnungen, welche in der Menschheit gerade durch den Sieg erweckt worden seien. Darüber hinaus sei sie auch für die Nation schädlich, da sie den im Krieg erlittenen ungeheuren Blutverlust des Landes vergrößerte.
Wie die Betroffenen unter den Folgen der Vertreibung gelitten haben
Es gibt Menschen, die in der Vergangenheit leben. Nicht aus nostalgischer Schwärmerei. Sie sind Gefangene der Zeit und können aus der Erinnerung an ihre seelische Qual nicht ausbrechen. Uns Vertriebene schmerzt am meisten der Verlust der Heimat. Es existieren viele Auslegungen des Heimatbegriffs. Das ist insofern aufschlussreich, weil wir dadurch erst genau wissen, was wir durch die Vertreibung verloren haben. Für uns ist die Heimat ein außergewöhnlich schöner und lebenswerter Landstrich, der viel zu bieten hat: eine glänzende wirtschaftliche Entwicklung, eine bewegte Geschichte sowie eine lebendige und bewusst erfahrene Tradition und Kultur. Für uns Ungarndeutsche ist Heimat der Geburtsort mit der prägenden Kraft für die Entwicklung der Persönlichkeit Wo man zu Hause im eigenen Haus ist, wo man die heimatliche Tradition pflegt, den Dialekt, die Gebräuche, die freie Ausübung der Religion, der Rede. Wo man inmitten des Familienverbandes aufwächst, was für uns Ungarndeutsche besonders wichtig war. Bei uns stand das Ideal der Gemeinschaft und der Familie im Vordergrund, nicht das Individuum. Die Fähigkeit, dies in seiner ganzen Tragweite zu begreifen, ist dem Westen abhandengekommen, wo jeder sich immer zuerst ums eigene Wohlergehen kümmert. Früher kämpfte man für sein Land, für seine Religion oder für seine Überzeugung. Heimat bedeutet nicht nur Bindung an einen bestimmten Ort, sondern auch eine Einbindung in den Alltag, die Auseinandersetzung mit der Umgebung, den Gewinn und Ausbau neuer Heimatbezüge. Das kann überall geschehen. Viele Menschen haben längst mehrere „Heimaten“. Das hatten wir Ungarndeutsche nicht. Mit unserer Heimat verloren wir auch die Wohnung, die uns Geborgenheit verschaffte. Nur noch Familie, Partnerschaft und Freundschaft sind wichtiger für die Geborgenheit. Die Geborgenheit gibt uns Sicherheit. Dieses Gefühl entsteht durch eine Wohnung. Hinzu kommt, dass man dort Heimat und Sorglosigkeit findet. Der Verlust der Wohnung kann existenzielle Angstgefühle hervorrufen. Wenn das Obdach, also der Schutz wegbricht, kann dies zur völligen Unsicherheit führen. Alles hängt mit dem Begriff Geborgenheit zusammen. Diese bezeichnet die Psychologie als ein „fundamentales Lebenssystem“. Darunter versteht man alles, was das persönliche Wohlbefinden fördert. Geborgenheit schließt Begriffe ein wie Nähe, Wärme, Behaglichkeit, Vertrauen, Ruhe, Frieden, innere Harmonie und vor allem Sicherheit. Die höchste Form erlebter Geborgenheit ist das Gefühl von Glück. Am bedeutendsten für das Glücksgefühl ist Licht, gleich an zweiter Stelle folgt die Geborgenheit. Durch die Vertreibung ist uns die Geborgenheit abhandengekommen. Das führte im schlimmsten Fall zu Verzweiflung und Depression. Je nach Person und Lebenslage sind alle Abstufungen bis zum Selbstmord möglich. Dass die Geborgenheit nicht von selbst kommt, haben schon unsere Einwanderer-Vorfahren gewusst. Von selbst kommt die Geborgenheit nicht, die Menschen müssen aktiv werden, um sich dieses Gefühl zu verschaffen. Das taten sie trotz widriger Umstände auch, indem sie zuerst mit Hilfe der Einheimischen ihre bescheidenen Häuser bauten. Darin konnten sie zunächst wohnen, was ihnen Geborgenheit verschaffte. Im Laufe der Jahrzehnte verbesserten sich die Wohnverhältnisse, auch wurden die Existenzgrundlagen breiter und effizienter. Das rief den Neid des ungarischen Mehrheitsvolkes auf den Plan, der schließlich zur brutalen Vertreibung führte. Vertreibung ist immer verbunden mit Unrecht, mit Flüchtlingselend, mit Verletzung der Menschenrechte und mit dem Verlust der Heimat. Das erlittene Unrecht ist ein bleibender Schmerz.
Die Vertriebenen und Flüchtlinge waren vor ihrer Vertreibung nicht arm. Die Armut war nach ihrer Vertreibung und Enteignung grenzenlos und voll schlimmer Entbehrungen. Sie mussten ein Leben am äußersten Rand der Existenz fuhren und dies nicht durch eigene Schuld oder Unvermögen. Außer dem Mangel an Nahrung und Kleidung stand für die Familie mit Kleinkindern nur ein kleiner Wohnraum mit feuchten Wänden und ohne jegliche sanitären Einrichtungen zur Verfügung. Geld gab es anfangs nicht. Die Folgen der Armut waren Erniedrigung, Entwürdigung, Stigmatisierung, Deprimierung und Reduzierung des Menschen auf das Lebensnotwendige. Sie äußert sich vor allem im sozialen Abstieg, Verlust an Wohlstand und Lebenschancen, in materieller Not, im Ausschluss aus der Gesellschaft, im Schwund des Selbstwertgefühls, in Verwahrlosung und Hoffnungslosigkeit. Der schwäbische Dichter Friedrich Hölderlin pflegte des Satz: „Wo aber Gefahr ist, kommt das Rettende auch“. Am 3. April 1948 trat das Europäische Wiederaufbauprogramm nach Vorschlägen des amerikanischen Außenministers George C. Marshall in Kraft. Neben dem Marshall-Plan wurden unter der Regierung Konrad Adenauer günstige politische Rahmenbedingungen wie die Soziale Markwirtschaft geschaffen. Die Einheimischen haben den Fleiß, den Sachverstand, die Ausdauer und Zuverlässigkeit entdeckt und ihnen mit Rat und Tat bei der Überwindung der Armut beigestanden. Die Armut der Flüchtlinge wurde zum fruchtbaren produktiven Ansporn, etwas zu leisten, um der Armut zu entkommen. Sie förderte die Selbstverantwortung der Betroffenen und gab ihnen ihre menschliche Würde wieder zurück. Manche errangen führende Stellen wie der in Leonberg von Flüchtlingseltern aus Zsámbék geborene Martin Winterkorn, der Vorsitzender des Volkswagenkonzerns mit über 200.000 Beschäftigten geworden ist.
Der schwerste Einschnitt im Leben der Ungarndeutschen war zweifellos die Zeit Ende 1944 und nach dem Zweiten Weltkrieg. Damals wurde die bislang homogene Dorfgemeinschaft absichtlich zerstört und die Familien getrennt. Ein unbeschreiblicher und meiner Meinung nach unbegründeter Deutschenhass hat sich plötzlich aufgestaut und entladen. Durch Vertreibung, Diskriminierung, Enteignung, Kriminalisierung, durch erzwungene oder freiwillige Magyarisierung ist die deutsche Volksgruppe, die zu Beginn des Zweiten Weltkriegs noch etwa 650.000 Menschen umfasste, an den Rand der Selbstauflösung geraten. Abhilfe schaffen sollte Zug um Zug das Minderheitengesetz als der Versuch, kulturelles Unrecht wieder gutzumachen. Eine wichtige Maßnahme auf diesem Wege stellt die Möglichkeit zur Wahl der Minderheitenselbstverwaltungen dar, wodurch die Gruppe in die Lage versetzt wird, sich zu sammeln und eigenverantwortlich im öffentlichen Leben des Landes teilzunehmen. Die deutsche Minderheit hat in ihrem Denken und Handeln nach über 60 Jahren immer noch Angst und Ängstlichkeit. „Wen einmal die Schlange gebissen hat, der fürchtet sich sogar vor der Eidechse“, sagt bekanntlich das Sprichwort. Leider ist es noch heute in Ungarn zuweilen so, dass das Andersartige Misstrauen hervorruft. Es könnte durch die Wahl von deutschen Minderheitenselbstverwaltungen mancherorts zu Spannungen zwischen deutscher und ungarischer Bevölkerung kommen. Manche sehen die zukünftigen Beziehungen zwischen Kommunalverwaltung und Minderheitenselbstverwaltung mit gemischten Gefühlen und meinen, wenn man bisher in Frieden miteinander gelebt hat, so vor allem deshalb, weil die Ungarndeutschen eben immer kleinlaut gewesen seien und nie ihr Recht gefordert hatten. Um das Selbstbewusstsein der Ungarndeutschen zu stärken, helfen nur Begegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften und die Pflege persönlicher Kontakte. Nur so werden sie in der Lage versetzt, ihre Persönlichkeit mit Selbstbewusstsein zu entwickeln.
Vielen Vertriebenen scheint vorzuschweben, trotz des verlorenen Krieges hätten sie in ihrer alten Heimat auf einer Insel der Seligen leben können! Tatsächlich lagen alle betroffenen Siedlungsgebiete im ehemals kommunistischen Herrschaftsbereich, mit den dort geltenden Beschränkungen und Unterdrückungen der bürgerlichen Freiheiten für alle Bewohner, nicht nur, aber eben auch für die Deutschen. Auch den verbliebenen Deutschen in Ungarn waren die Freiheiten genommen oder zumindest beschnitten worden, eine eigene Meinung zu bilden, sich zu informieren, den Beruf nach eigenen Vorstellungen auszuüben, Eigentum an Häusern, Höfen und Betrieben u erhalten, ihr Privatleben nach Gutdünken zu gestalten, zu reisen. Manche waren allein aufgrund ihrer sozialen Stellung inhaftiert oder ermordet worden. Diejenigen Vertriebenen, die außerhalb der Reichsgrenzen von 1937, wie die Ungarndeutschen, gewohnt hatten, waren zusätzlich Opfer ethnischer Verfolgungen geworden: Viele waren in Gulags verschleppt. Den Ungarndeutschen war der Gebrauch der Muttersprache verboten. Stattdessen erhielten die Millionen Vertriebenen im Westen Deutschlands frühzeitig eine Starthilfe in Form von Soforthilfe und Lastenausgleich, die den Möglichkeiten des verarmten und auch hier weithin zerstörten Landes entsprach. Zusammen mit der einheimischen Bevölkerung konnten die Vertriebenen an den Wiederaufbau gehen, am „Wirtschaftswunder“ teilhaben. Unterschiede in der sozialen Stellung und im Wohlstand unserer Landsleute, die sich mit der Vertreibung in Zusammenhang bringen lassen, dürften schon seit Jahren im Westen nicht häufig auszumachen sein. Vor allem aber durften die Vertriebenen wie die Alteingesessenen hier ihr Leben in Freiheit gestalten.
Schrifttum:
Ungváry Krisztián: Vorurteile und Diskriminierungen gegen Juden und
Deutsche in den 1920er und 1930er Jahren. Vortrag, gehalten bei der
Kulturtagung der Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn am 8. Oktober
2005 in D-70829 Gerlingen.
Dokument einer Regierungssitzung vom 22. 12. 1945, Aus: Pester Lloyd vom
22. Januar 1997.
Bellér Béla: Egy gyönge Vétó (Ein leises Veto) in Élet és Irodalom vom
16. Oktober 1987, ins Deutsche übersetzt von Franz Wesner.
_______________________________________________________________________________________________
Der Verfasser Georg Richter wurde am 15. 08. 1926 in Nadwar/Nemesnádudvar im Süden des Komitats Batsch geboren. Er wuchs dort auf, besuchte dort nach vier Jahren Volksschule acht Jahre lang das Jesuitengymnasium in der Bischofsstadt Kalotscha, wo er Abitur machte. Als Deutscher wurde auch er im September 1944 zur Waffen-SS eingezogen, geriet am 12. 2. 1945 in sowjetische Kriegsgefangenschaft. Diese dauerte sechs Jahre bis November 1950. Danach wurde auch er mit etwa 1200 ungarndeutschen Landsleuten den kommunistischen ungarischen Behörden übersteht, wo auch er noch drei Jahre Zwangsarbeit unter menschenunwürdigen Bedingungen leisten musste. Am 2. 3. 1952 wurde er von der ungarischen Staatssicherheit zum Kriegsverbrecher erklärt. Auf Druck der Westmächte wurde auch er am 3. 12. 1953 des Landes verwiesen mit der Folge des Verlusts der ungarischen Staatsbürgerschaft. Nach der Entlassung fand Richter in der Bundesrepublik Deutschland eine neue Heimat. Deutschland gab ihm auch seine Menschenwürde zurück. In der neuen Heimat hat Richter inzwischen die Vorzüge des sozialen Rechtsstaats kennengelernt. Die Menschen sind offen, wohlerzogen, anständig, hilfsbereit, korrekt, berechenbar und freundlich.